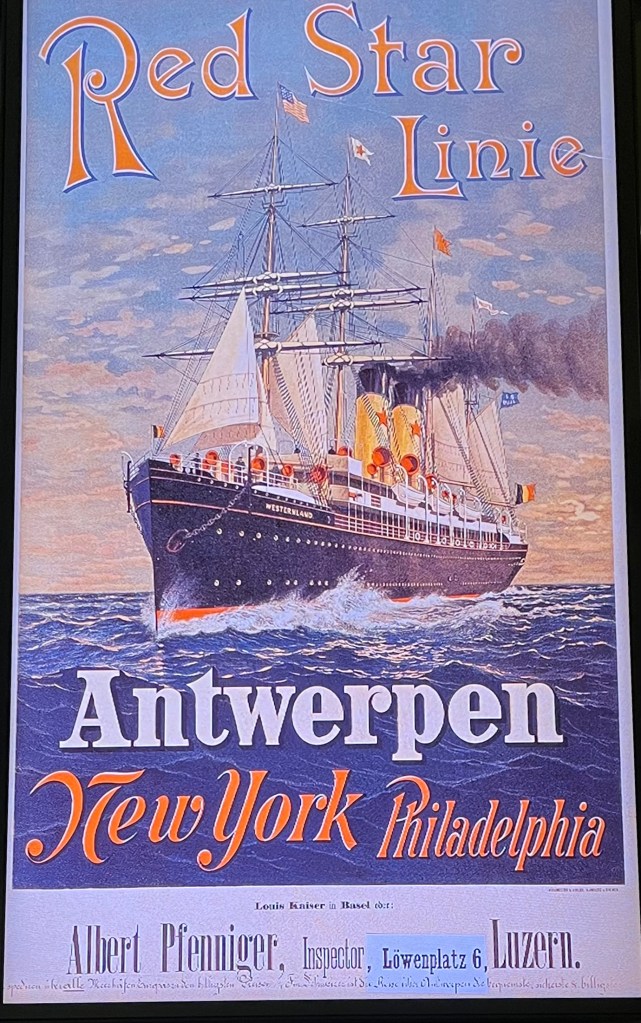Ich mag Weihnachten, Silvester und meinen Geburtstag nicht besonders. Schon als Kind graute mir vor der Vorstellung der geplanten Feier: Jetzt wird es lustig, gemütlich oder was auch immer. Freude auf Knopfdruck liegt mir nicht, und Vorfreude empfinde ich kaum. Ich bekomme viele gut gemeinte Gratulationen und Geschenke, mit denen ich oft nichts anfangen kann. Dazu kommt das erzwungene Gefühl, auf alle Glückwünsche freudig reagieren zu müssen.
Was ich hingegen mag, ist, spontan oder kurzfristig mit meinen ehemaligen Schulkollegen, Freunden und Freundinnen etwas auszumachen – zu zweit, zu dritt oder in einer grösseren Gruppe – und einen lustigen, unverbindlichen Abend oder ein Wochenende ohne Agenda und Hintergedanken zu verbringen.
Jetzt ist es wieder so weit. Ich habe Geburtstag. Alle Jahre wieder im Januar. Meine Freundinnen schreiben mir, und das freut mich wirklich, denn das sind authentische Glückwünsche mit ehrlichen Angeboten, gemeinsam wandern zu gehen oder ins Kino, Theater oder eine Ausstellung. Sie kennen mich und wissen, dass mich materielle Geschenke selten glücklich machen. Die Kinder melden sich, die Eltern und weitere Verwandte schreiben. Einige alte, langjährige Geschäftspartner lassen von sich hören. Und dann bekomme ich Anrufe und Mails, die durch Kalendereinträge von Versicherungen, der Garage oder anderen Dienstleistern ausgelöst werden. Die SBB schenkt mir einen Gutschein für ein Getränk, Ticketcorner eine 5-Franken-Ermässigung. Ich möchte nicht undankbar wirken, aber ehrlich: Ich brauche keine KI, die programmiert wurde, um meinen Geburtstag zu beachten. Das macht keinen Spass.

Ich war bei meiner Mutter zu Besuch, um ihr bei der Einstellung ihrer Hörgeräte zu helfen. Jetzt fliege ich an meinem Geburtstag zurück nach Hause. Ich setze mich auf meinen Sitz – und da ich ein super günstiges Ticket gekauft habe, überrascht es mich nicht, dass ich wieder wie schon auf dem Hinflug in der letzten Reihe des Flugzeugs eingecheckt wurde. Ein Aufpreis für 15 Reihen weiter vorne zu sitzen, ist es mir nicht wert. Lesen kann ich überall, nachdenken ebenfalls. Ich mache es mir bequem, öffne meinen Laptop und beginne zu arbeiten. Dann kommt die Stewardess und fragt mich, ob ich Frau Merz sei. Ja, das bin ich. Sie gratuliert mir und überreicht mir eine Tafel Schokolade. Und das hat mich tatsächlich berührt. Das Unerwartete traf mich emotional. Swiss, gut gemacht – ich habe mich über diese Gratulation sehr gefreut.
Übrigens habe ich dieses Jahr nach langer Zeit wieder einen materiellen Wunsch: Ich möchte mir gerne einen Billardtisch kaufen. Das ist allerdings ein anspruchsvoller Wunsch. Ein Billardtisch ist gross und schwer. In meiner Wohnung ist kein Platz dafür. Aber im Ferienhaus wäre es möglich, den Raum über dem alten Stall aufzustocken und dort den Tisch aufzustellen. Das ist jetzt mein Geburtstagswunsch und vermutlich ein Projekt für die nächsten drei Jahre. Ich brauche einen Architekten, der sich mit alter Bausubstanz auskennt. Die Wände bestehen aus Stein, das Haus wurde 1906 erbaut, die Ställe wahrscheinlich über 100 Jahre früher. Ich brauche einen Bauleiter und eine Baugenehmigung. Die Realisierung wird sicher anspruchsvoll, da durch die Aufstockung vermutlich ein komplett neues Dach nötig wird. Wie immer ist mein Budget begrenzt, und alles muss hineinpassen.
Warum Billard? Ich habe in den Ferien nach langer Zeit wieder fast jeden Tag gespielt. Ich bin überhaupt nicht gut. Mir hat schon immer das dreidimensionale Sehen gefehlt, und Geometrie war für mich ein Horrorfach. Als ich mit 14 einen Intelligenztest gemacht habe (als Hilfe für die Berufswahl), erzielte ich im Bereich der räumlichen Visualisierung null Punkte. Man liess mich diesen Teil des Tests wiederholen, weil der Verdacht bestand, dass etwas schiefgelaufen sei. Das Ergebnis blieb jedoch gleich: null Punkte. Es gibt Dinge, die ich einfach nicht kann. Für Billard ist die Fähigkeit zur räumlichen Visualisierung von grossem Vorteil. Seitlich einzuparken, konnte ich erst nach langem Suchen nach einer Strategie. Heute schaffe ich es ohne weiteres und schwitze nicht mehr wie in den ersten 20 Jahren mit Führerschein. Ich erinnere mich an Kollegen und Fahrlehrer, die mir versprochen haben, es mir beizubringen – keiner hat es geschafft. Ich musste selbst herausfinden, wie ich diese fehlende Fähigkeit kompensieren kann.
Mit Billard ist es ähnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ich eine Kugel durch eine andere stosse, aber mittlerweile kann ich einiges analytisch ableiten. Meine Schwäche zu überlisten, macht mir grossen Spass. Ich brauche den Billardtisch, um besser zu werden; dafür braucht es die Aufstockung, und diese benötigt die Baugenehmigung, die mir ein Architekt und Bauleiter besorgen sollten. Falls ihr tolle Architekten oder Bauleiter kennt, wäre das für mich ein wunderbares Geburtstagsgeschenk.

Ich habe schon wieder Geburtstag. Swiss, danke für die Schokolade.