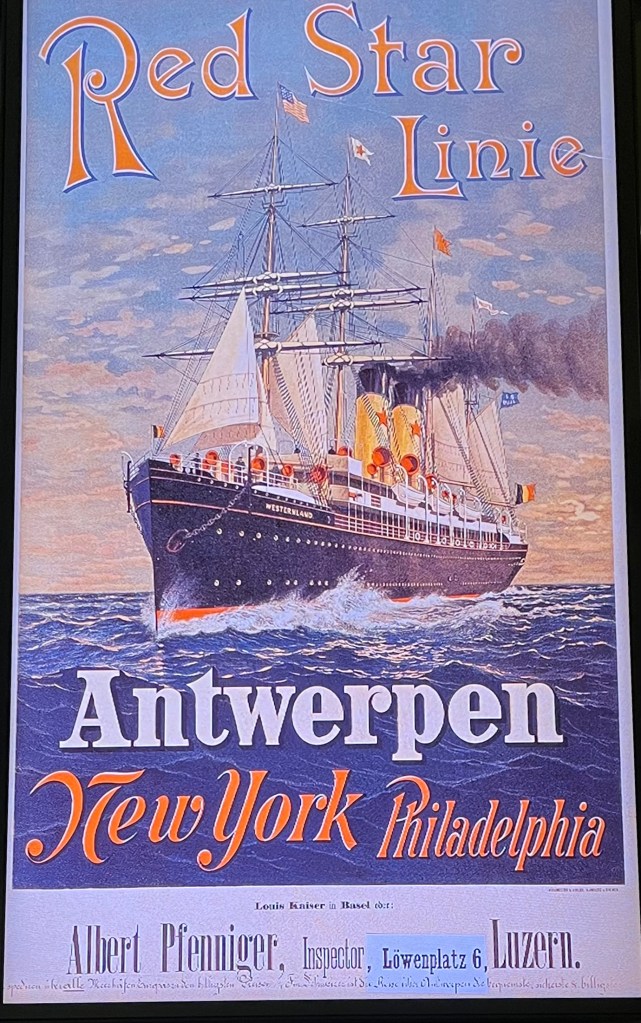Ich habe das Gefühl, dass die Welt mindestens seit Corona ihre Nettigkeit verloren hat. Ich werde zwei Sekunden nachdem das grüne Licht erscheint angehupt, wenn ich nicht sofort losfahre.
Wenn ich einen Abstand zum Fahrzeug vor mir halte, der mir erlaubt, in jeder Situation rechtzeitig zu bremsen, passiert es mit eiserner Regelmässigkeit, dass sich in das Loch (wahrscheinlich als unangemessen gross wahrgenommen) ein anderes Fahrzeug hinein schiebt. Ein “Danke” oder “Bitte” und erst recht eine Entschuldigung sind im öffentlichen Raum so dünn gesät wie die rare Erde auf diesem Globus. Etwas Nettes zu hören, kommt so selten vor, dass man es sich für die Ewigkeit merkt. Als wäre die globale Situation nicht schon schwierig genug, machen wir uns gegenseitig das Leben schwer. Man ruft schnell aus, die Toleranzgrenze ist unter den Gefrierpunkt gesunken, und anstatt miteinander zu reden, mit ehrlichem Willen, die Probleme zu lösen, wird die Polizei eingeschaltet. Ein Beispiel: Wenn der Nachbar noch fünf Minuten nach 22 Uhr Lärm macht. Es wurden Juristen eingeschaltet und viel Geld ausgegeben (was nicht weiter schlimm ist, da die Rechtsschutzversicherung zahlt), wo man eigentlich diskutieren und nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suchen sollte.
Mich stört das zunehmend. Etwas zu ändern, erfordert den Einsatz vieler (wenn schon nicht aller) in einer dauerhaften Weise. Ich habe bei mir selbst angefangen. Meine E-Mails (fast alle) lässt jetzt die künstliche Intelligenz anpassen, macht sie besser und mich zu einem besseren Menschen. Der Ton wird weicher, die Sprache ausschweifender und netter. Die Botschaften werden in Watte gepackt. Das alles dauert nur ein paar Sekunden, und alle, die mich lange genug kennen, erkennen es sofort. Das ist sogar gewollt. Es liegt mir fern, mich mit falscher Feder zu schmücken. Der Effekt ist jedoch zweischneidig. Zum einen verlieren meine E-Mails an Authentizität. Das bin nicht mehr ich. Aber zum anderen – und das ist die Wahrheit – waren meine E-Mails nicht immer leicht zu verdauen. Ich bin eine direkte Person und mir ist bewusst, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ich versuche, mich selbst zu bremsen, was mir wahrscheinlich nicht immer gelingt. Ab jetzt hoffe ich, dass meine E-Mails niemanden mehr verletzen können. Das ist schon etwas.
Ich habe bewusst angefangen, bei jedem Menschen das Positive, das Herausstechende, das, was auffällt, zu suchen. Ab und zu ist es harte Arbeit, es auf Anhieb zu finden, aber jeder hat etwas. Und das Hervorragende, Ausstechende benenne ich laut. Schlussendlich entspricht es der Wahrheit. So könnten alle zu ihrer täglichen Portion Nettigkeit kommen, ohne sich zu verstellen. Es ist, wie so oft, nur eine Willensfrage.
Am Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr, war ich in der Bäckerei, um Brot zu kaufen. Neben mir, mit einem Tablett in der Hand, stand die kleine Verkäuferin, die dort schon seit Jahren arbeitet und immer ausgesprochen nett ist. Sie erinnert sich sogar an meinen Namen und grüsst mich mit Namen. Ich habe sie sehr gern. Auf ihrem Tablett stand eine Tasse – wahrscheinlich Kaffee –, ein Glas Wasser und ein Papiersack, bei dem es schwer war, zu sagen, was genau darin war. Der Sack war nicht gross, aber auch nicht klein. Ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ihr ihre jahrelange Nettigkeit zurückzugeben. Ich sagte zu der Kassiererin hinter dem Pult, dass ich das Brot und ihr Frühstück ebenfalls bezahlen werde. Ich drehte mich zu ihr und erklärte ihr, wie nett ich sie finde und dass ich gerne ihr Frühstück heute bezahlen möchte. Sie war verlegen, aber sagte, dass es nett sei, sie aber selber zahlt. Sie sagte es jedoch nicht in einem kategorischen Ton, der keinen Widerspruch duldete. Ich insistierte und sie zögerte weiter. Nach mehrmaligem Hin und Her willigte sie schliesslich ein. Wie gross war aber meine Überraschung, als ich den Preis hörte, den ich zahlen musste: 1,20 Franken. Ich verstand die Welt nicht mehr. Vielleicht haben sie mir Mitarbeiterpreise berechnet und für den Kaffee mussten die Mitarbeiter nichts zahlen. Ich fragte nach, ob sie sich im Preis geirrt haben und ob alles in Ordnung sei, aber es wurde mir bestätigt, dass alles stimmt. Ich war eher von 10 Franken und mehr ausgegangen.
Ich hoffe, dass ich es geschafft habe, auch mit nur 1,20 Franken Freude zu machen und ein bisschen Nettigkeit zurückzugeben